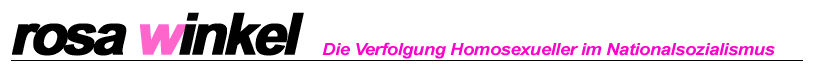 |
|
|
|||||||
 |
|||||||
 |
|||||||
Willi HeckmannMusikerWilhelm Heckmann wird am 26.6.1897 in Wellinghofen geboren. Als Sohn eines Wirtes, der seine Gäste mit musikalischen Darbietungen unterhält, steht Heckmann junior mit seiner „glockenreinen Stimme“ schon in jungen Jahren auf der Bühne. Nach dem Ersten Weltkrieg studiert er am städtischen Konservatorium in Hagen Tenorgesang und Piano. Seit 1923 tourt er durch Deutschland – in der Musikerzeitschrift Der Artist wirbt er für sich als vielseitigen "Stimmungspianisten". Heckmann tritt als "Sänger am Flügel" mit Opernarien und Chansons auf, später mit den neu aufkommenden Schlagern.Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten kann Heckmann seine Tätigkeit zunächst fortsetzen. Seit 1934 berichtet Der Artist mehrfach über seine Auftritte, so etwa im Münchener Café Gottschalk: "Dezent passt er sich dem Publikum an und hat sich im Laufe der vielen Monate in diesem Engagement einen großen Stamm von Freunden und Gönnern gewonnen." Hinsichtlich seiner sexuellen Vorlieben ist Heckmanns Anpassungsfähigkeit allerdings geringer. Im Juli 1937 wird er nach einem Auftritt in der Passauer "Regina-Diele" verhaftet. Am 29.7.1937 überführt man ihn in die Münchener Gestapozentrale. Zur Last gelegt wird ihm Homosexualität. |
 |
||
|
Werbepostkarte
von Willi Heckmann |
|||
|
Die genauen Hintergründe der Verhaftung sind unklar. Heckmann erklärt später, ohne akuten Anlass festgenommen worden zu sein. Hinweise auf einen Prozess wegen § 175 finden sich in den in Frage kommenden Archiven nicht. Heckmann wird offenbar ohne Strafverfahren in "Schutzhaft" genommen und ins KZ Dachau eingewiesen – ein im Rahmen der Homosexuellenverfolgung eher ungewöhnliches Vorgehen. Nach zwei Jahren in Dachau wird Heckmann 1939 ins Konzentrationslager Mauthausen verlegt. Wie die meisten "Rosa-Winkel-Häftlinge" wird auch er der Strafkompanie im Steinbruch zugeteilt. Heckmann gelingt es schließlich, das Wachpersonal auf sein musikalisches Talent aufmerksam zu machen. Zunächst 'darf' er mit einem Trio für SS-Angehörige und die Lagerleitung musizieren. Später leitet er das sogenannte "Zigeunerorchester" und wirkt beim großen Lagerorchester als Harmonikaspieler und Schlagersänger mit. Dieser Aufstieg in der 'Lagerhierarchie' ist es denn wohl auch, der Heckmann das Überleben sichert. Nach der Befreiung versucht er wieder als Berufsmusiker Fuß zu fassen. Er spielt als Alleinunterhalter in verschiedenen Hotels und Restaurants. Doch es gelingt ihm nicht, an seine Vorkriegserfolge anzuknüpfen. Nicht zuletzt wohl auch deswegen, weil er unter den Nachwirkungen der langjährigen KZ-Haft leidet. In einem Antrag auf Wiedergutmachung schreibt er 1954, er habe unter "Rheuma und Nervenentzündungen in den Schulter- und Armgelenken zu leiden, was mich in der Ausübung meines Berufes stark behindert“. Der Antrag wird 1960 abgelehnt mit der Begründung, er sei "nur als Homosexueller wegen Verbrechens gegen § 175 StGB in Haft gehalten" worden – im Bundesentschädigungsgesetz wird Homosexualität als Verfolgungsgrund nicht anerkannt. Wie viele in der NS-Zeit verfolgte Homosexuelle heiratet Heckmann nach dem Krieg. In seiner Familie wird die Verfolgungsgeschichte tabuisiert und auch Heckmann schweigt darüber. Nach seiner Verrentung in den späten 60er Jahren führt er ein zurückgezogenes Leben in Wuppertal, wo er am 10.3.1995 stirbt.
Der Dokumentarfilm "Klänge des Verschweigens" Erst wenige Jahre vor Heckmanns Tod erfährt sein Neffe Klaus Stanjek durch Zufall von der KZ-Haft des Onkels. Er beginnt zu recherchieren und arbeitet mehr als zwei Jahrzehnte an einem Dokumentarfilm über Heckmanns Schicksal. 2012 feiert der Film "Klänge des Verschweigens" schließlich Premiere. Der Film dokumentiert die Lebensgeschichte Heckmanns, in erster Linie geht es aber um die Tabuisierung des Themas nach 1945. Ohne Umschweife thematisiert Stanjek das von Mutter und Tanten in die Welt gesetzte Gerücht, der Onkel habe eine Vorliebe für kleine Jungs gehabt, ja er habe einen Hitlerjungen verführt, den Sohn eines prominenten Nazis, und sei deswegen ohne Prozess direkt ins KZ gekommen. Sofort drängt sich die Frage auf: Müssen wir uns mit solchen Klischees wirklich auseinandersetzen? Stanjek, der eine sehr emotionale Beziehung zu seinem Onkel hatte, macht es. Er befragt sich selbst, rekonstruiert mit animierten Szenen die kindlichen Spiele mit seinem Onkel, gemeinsam in einem Bett. Und er fragt sich: War das eventuell mehr? Habe ich etwas verdrängt? Doch so befremdlich diese Frage auf den ersten Blick wirken mag, so richtig ist es, sie zu stellen. Denn sie führt ins Zentrum des Films: Zu der Frage, wieso das 'Geheimnis' des Onkels, von dem merkwürdigerweise fast alle wussten, so lange verschwiegen wurde. Mit seiner schonungslosen Interview- und Kameraführung gelingt es Stanjek schließlich, der Verwandtschaft mehr zu entlocken, als ihr lieb ist. Und das Fortwirken der Stereotype, mit denen die Nationalsozialisten Homosexuelle zu Volks- und Staatsfeinden stilisierten, zu entlarven. Der "homosexuelle Kinderschänder", so zeigt sich bald, ist vor allem ein Fantasiebild, evoziert durch die Propaganda, die die Verfolgungsmaßnahmen begleitete und für die nicht nur Stanjeks Mutter als BDM-Führerin äußerst anfällig war. Über Jahrzehnte
verhindert der schlimme Verdacht jegliche Kommunikation über
die langen Leidensjahre des Onkels. Ein Problem, zu dem auch Heckmann
beiträgt, indem er beharrlich schweigt und sich auch den Fragen
des Neffen verweigert. Und so bleibt lange nichts als ein "wissendes
Beschweigen", das nicht nur das Familienleben der Heckmanns/Stanjeks
prägt, sondern typisch erscheint für das gesellschaftliche
Klima der frühen Bundesrepublik, ja womöglich typisch
für einen Umgang mit dem "Tabu" Homosexualität,
den viele Familien bis heute pflegen. Weitere Informationen: http://www.klaenge-des-verschweigens.de/ |
|||
![]()
© Alexander Zinn 2017






