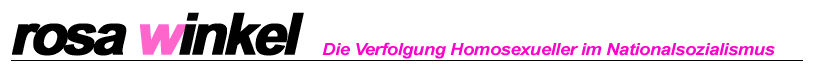 |
|
|
|||||||
 |
|||||||
 |
|||||||
Walter SchwarzeFriseurWalter Schwarze wird am 24.12.1914 in Leipzig geboren. Der Vater ist Postbeamter und engagierter Sozialdemokrat. Auch die Mutter ist Mitglied der SPD, überdies leitet sie eine Arbeiterbibliothek. Nach acht Jahren Volksschule macht Schwarze eine Ausbildung zum Friseur.Schon in der Schulzeit bemerkt Schwarze seine homosexuelle Neigung: Mit den Worten „Ich glaube, ich liebe Männer, sei mir nicht böse“, offenbart er sich einem Schulfreund, zu dem er noch lange Kontakt hält. In seinem Elternhaus kann sich Walter dagegen niemandem anvertrauen. Er ahnt schon früh, dass Homosexualität für seine Eltern ein großes Tabu ist. Und auch zu seinen beiden Brüdern und der Schwester hat er kein Vertrauen. Als er schließlich einen jungen Mann aus Bitterfeld kennenlernt, kommt es zum Eklat. Hans, so heißt er, schenkt Walter zu Weihnachten einen silbernen Leuchter. Eingraviert steht darauf: „In Liebe, dein Hans.“ Als der Vater die Inschrift entdeckt, schmettert er den Leuchter wutentbrannt an die Wand. „Den Kerl nehme ich mir vor. Du bist normal geboren und du unterliegst einer Verführung. Das lasse ich mir als Familienoberhaupt nicht gefallen!“ So seine Worte. Und auch die Mutter reagiert sehr abweisend: „Drei ledige Kinder könnest du mir bringen, die ziehe ich alle groß. Aber das, das überwinde ich nie. Das ist eine Schande für die ganze Familie.“ |
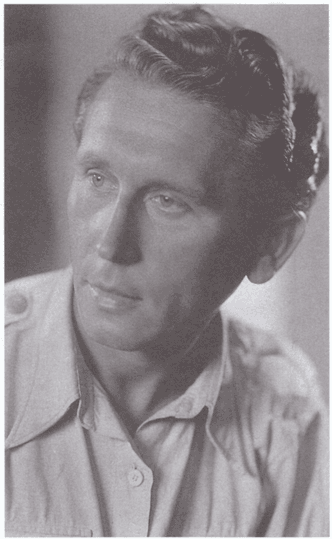 |
|
|
Walter Schwarze
im Jahr 1961 |
||
|
Sicherlich auch aufgrund der Reaktion seiner Eltern hat Schwarze von Beginn an ein gebrochenes Verhältnis zu seiner Homosexualität. Über sein schwules Leben in den 30er Jahren will er auch sechzig Jahre später nur wenig erzählen. Gleichwohl hat er damals Kontakte zu anderen Homosexuellen. Und mit Hans hat er auch einen festen Freund. Mitte Mai 1940, nach einem Kurzurlaub in der Sächsischen Schweiz, besucht Schwarze die Leipziger Gaststätte „Burgkeller“ – ein beliebter Treffpunkt Homosexueller. Dort wird er von einer jungen Frau angesprochen, die ihn fragt, ob er denn nicht bei der Armee sei. Schwarze erzählt frei von der Leber weg, dass viele seiner Schulfreunde schon gefallen seien: „Muss Adolf denn so ein Blutvergießen anrichten? So ein Elend über die Menschen verbreiten? Über alle Länder?“ Mit diesen Worten, so Schwarze später, habe er der jungen Frau geantwortet. Diese steht auf und verlässt den Tisch. Schwarze geht zur Toilette. Dort warten bereits zwei Gestapo-Beamte, die ihn festnehmen. Schwarze ist in eine der „unauffällig durchgeführten Razzien“ der Geheimen Staatspolizei geraten. Diese sucht in Gaststätten wie dem Burgkeller nach Homosexuellen. Dafür werden auch Agents Provocateurs eingesetzt, die mit ihren Opfern anbändeln, bevor sie sie verhaften. Schwarze hingegen wird zunächst wegen seiner politischen Äußerungen verhaftet. Erst durch die folgende Hausdurchsuchung, bei der Liebesbriefe seines Freundes gefunden werden, wird seine Homosexualität offenbar. In den Verhören der Gestapo bekennt er sich daraufhin zu seiner Veranlagung. Das Angebot, als Gestapo-Spitzel im sogenannten „Homosexuellenmilieu“ zu arbeiten, lehnt er ab. Am 22.6.1940 wird Schwarze von der Gestapo ins Leipziger Polizeigefängnis überstellt. Schon kurze Zeit später, so seine Erinnerung, wird er dann zu einer Gerichtsverhandlung gebracht. Weder ein Staatsanwalt noch sein Rechtsanwalt nehmen daran teil, so zumindest die Erinnerung von Schwarze. Der Richter fragt ihn, ob er homosexuell sei, was Schwarze ehrlich bestätigt. Handlungen, die nach § 175 strafbar wären, kann man ihm aber nicht nachweisen. Zum Schluss der Verhandlung erklärt der Richter, es gebe keinen Paragrafen, den Angeklagten zu verurteilen. Aber „im nationalsozialistischen Sinne“ sei er „zu erziehen“. Schwarzes Hoffnung,
entlassen zu werden, wird enttäuscht. Er kommt erneut in Untersuchungshaft.
Und dort erhält er Besuch von einem Gestapo-Beamten, der ihm
drei Zettel zur Unterschrift vorlegt. „Umschulung auf ein ¼
Jahr“, auf „1 Jahr“ oder auf „unbestimmte Zeit“,
habe darauf gestanden. Und: „Heimkehr unerwünscht“.
„Ich habe in meiner Rage, in meiner Nervosität gar nicht
gewusst, was ich unterschreibe“, erinnert sich Schwarze später.
Die folgende Nacht verbringt Schwarze im Gefängnis von Berlin Moabit. Dort versucht ein anderer Gefangener, sexuellen Kontakt aufzunehmen. Schwarze ist entsetzt. „Mein einziger Gedanke war, hier herauszukommen – nur in das Konzentrationslager. Den Gedanken, was das eigentlich ist, habe ich mir nicht gemacht... Ich habe wirklich daran geglaubt: an Umschulungslager, an ein politisches Umschulungslager, oder an Wehrertüchtigung oder Vorbereitung auf die Armee oder auf die Wehrmacht.“ Am 19.12.1940 wird Schwarze in Sachsenhausen eingeliefert. „Da wurde jede einzelne Person aus dem Wagen herausbeordert, jeder kriegte mit dem Gummiknüppel eins abgereicht...“ Als Walter Schwarze an der Reihe ist, wird er von einem SS-Schergen durchsucht. In seiner Tasche findet man das Foto einer Freundin: „Und da guckt er das Bild an, schüttelt mit dem Kopf. Er guckt mich an, und ich habe keinen Schlag gekriegt. Wohl zu vermerken: keinen Schlag. Während 20 einen Schlag gekriegt haben, fürs Genick, oder mit der Faust ins Gesicht.“ Wie fast alle anderen homosexuellen Häftlinge wird auch Schwarze in die so genannte „Isolierung“ eingewiesen. Dabei handelt es sich um ein „Lager im Lager“, um vier bis sechs Häftlingsbaracken, die vom restlichen Konzentrationslager mit einem Zaun abgetrennt sind. Die Homosexuellen werden in die Isolierung eingewiesen, um die Verbreitung der „Seuche“ Homosexualität im restlichen Lager zu bannen, so der damalige Schutzhaftlagerführer und spätere Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß. Und der SS-Terror ist hier besonders grausam. Die Blockführer der SS, oft aber auch die Blockältesten, bei denen es sich um Häftlinge handelte, erproben immer neue Quälereien und Folterpraktiken. Tagsüber werden die Gefangenen u.a. in der Strafkompanie Schuhläufer geschunden. Elf Stunden müssen sie über eine Prüfstrecke aus Kies, Sand, Schlamm und Kopfsteinpflaster marschieren, um im Auftrag des Reichswirtschaftministeriums Schuhe, Socken und andere Kleidungsstücke auf ihre Haltbarkeit zu überprüfen. Auch Schwarze ist zeitweise in der Strafkompanie Schuhläufer: „Aus der Isolierung bin ich nur herausgekommen mit den Schuhen, die wir einlaufen mussten für die Wehrmacht“, so seine Erinnerung. Ansonsten ist er im Stehkommando. Das heißt Strammstehen, den ganzen Tag. Wer das nicht schafft, ist dem Tod geweiht. Als ein Häftling im Mai 1941 vor Erschöpfung zusammenbricht, wird er auf Anweisung des SS-Mannes Otto Kaiser in den Duschraum getragen und mit kaltem Wasser traktiert. „Da soll sich das schwule Schwein wieder erholen“, kommentierte Kaiser den Vorgang. Nach dem Mittagessen liegt der Häftling immer noch unter der kalten Dusche, inzwischen ist er tot. „Abspritzen“ mit kaltem Wasser ist eine beliebte Mordmethode. Stundenlang wird mit einem Wasserstahl auf die Herz- und Nierengegend gezielt. Auf dem Totenschein steht dann „Herzkollaps“ oder „Herz- und Kreislaufversagen“. Schwarze bekommt den geschilderten Mord nicht mehr mit. Als im April 1941 Freiwillige für den Aufbau des Konzentrationslagers Groß Rosen bei Breslau gesucht werden, meldet er sich sofort. „Ich habe nur weggehen wollen“, erklärt er die spontane Reaktion. Schlimmer als in der „Isolierung“ von Sachsenhausen konnte es seiner Ansicht nach nirgendwo sein. Von den berüchtigten Steinbrüchen anderer Konzentrationslager hatte er damals noch nicht gehört. Tatsächlich rettet die Meldung für Groß Rosen Walter Schwarze wohl das Leben. Denn so entgeht er der Mordaktion vom Sommer 1942, der damals fast alle homosexuellen Häftlinge von Sachsenhausen zum Opfer fallen. Von Juli bis September 1942 mindestens 200 schwule Männer ermordet. 89 der Ermordeten sind uns heute namentlich bekannt. Die Transportlisten nach Groß Rosen weisen Schwarze als Nummer „260 - § 175“ aus. In Groß Rosen kommt er Anfang Mai 1941 an. Schwarze wird im Barackenbau und kurze Zeit auch im Steinbruch eingesetzt. Als er sich gegen sexuelle Übergriffe eines anderen Häftlings zur Wehr setzt, bekommt er die Unterstützung einiger politischer Häftlinge. Diese sorgen schließlich auch dafür, dass er bei leichteren Arbeiten eingesetzt wird, als Läufer oder im Stubendienst. Mehrfach erkrankt er in den folgenden Jahren, Fleckfieber, Bauchtyphus, Ruhr und Cholera sichern ihm immer wieder einen Platz im Krankenrevier und schützten ihn so vor der von den Nationalsozialisten angestrebten „Vernichtung durch Arbeit“. So paradox es klingt, die Krankheiten, so meinte Schwarze später, hätten ihm das Leben gerettet. Irgendwann um die Jahreswende 1943/44 versucht Schwarzes Mutter, ihn im Konzentrationslager zu besuchen. Sie kämpft um seine Freilassung und hat schließlich sogar Erfolg. Am 24. April 1944, nach fast vier Jahren Gefangenschaft, wird Walter Schwarze in die Wehrmacht entlassen. Nun soll er plötzlich für den Staat kämpfen, der ihn ins Konzentrationslager gesteckt hat. Doch Schwarze ist froh, im Gegensatz zu den meisten anderen der Hölle der KZ’s entkommen zu sein. Nur das zählt! Erneut hat Schwarze Glück im Unglück: Auf seinen Entlassungspapieren aus dem KZ wird kein Haftgrund genannt. Bei der Wehrmacht steckt man ihn im Gegensatz zu vielen anderen Homosexuellen, die aus Gefängnis oder KZ zum Militär entlassen werden, nicht in eines der Himmelfahrtskommandos, die den sicheren Tod bedeuten. Schwarze erfüllt seine Dienstpflicht in Schreibstuben und in technischen Abteilungen, erst in Frankreich, später in Schlesien, Nordböhmen und Österreich. In den letzten Kriegstagen gerät er bei Havelberg in der Prignitz in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Damit beginnt das nächste Martyrium des Walter Schwarze. Dass er über drei Jahre in den Konzentrationslagern der Nazis gelitten hat, glaubt ihm keiner der sowjetischen Offiziere. Schwarze wird als Kriegsgefangener in sowjetische Arbeits- und Straflager deportiert. Nach Minsk, Kiew und ins Donezbecken, wo er nach einem Arbeitsunfall zeitweise erblindet. Immer wieder wird seine Entlassung verschoben. Erst im Oktober 1949 kommt er frei. Schwarze geht zurück in seine Heimatstadt Leipzig, wo er zunächst bei seinen Eltern wohnt. Das Thema Homosexualität ist in der Familie weiterhin Tabu. Und auch Schwarze möchte mit seiner homosexuellen Veranlagung am liebsten nichts mehr zu tun haben. Die Jahre der Gefangenschaft haben ihn endgültig gebrochen. Gleichwohl erkundigt er sich eines Tages nach seiner alten Liebe Hans aus Bitterfeld. Daraufhin bekommt er Folgendes zu hören: „Er ist jetzt verheiratet, hat schon zwei Kinder. Als sie dich verhafteten, hatte er panische Angst. Aber es ist ihm nichts passiert. Er meinte, du seiest ein Riesenrindviech gewesen, alles zuzugeben.“ Auch Schwarze versucht nun, ein heterosexuelles Leben zu führen. Zwei Mal heiratet er Frauen. Doch beide Ehen gehen in die Brüche: „Ich habe immer wieder versucht, so zu leben wie die anderen Menschen. Ich habe immer wieder gedacht: ‚Lieber Gott, lass mich doch nicht so werden’. Ich habe gekämpft wie ein Löwe. Ich wollte es nicht mehr sein. Und wenn ich es noch einmal wäre, im ersten Bad würde ich mich ersaufen.“ Schwarze ist durch den NS-Terror gebrochen worden. Halt gibt ihm später die Freundschaft zu Ali, den er 1978 kennenlernt und überall als seinen Sohn vorstellt. Doch zeitlebens kann er kein wirklich positives Verhältnis zu seiner Homosexualität aufbauen. Auch nach der Wende von 1989/90 nicht, als er sich und seine Geschichte schließlich offenbart. Auf eine Anzeige in der Leipziger Volkszeitung meldete er sich damals bei der Journalistin Maxi Wartelsteiner. Sie hatte nach Homosexuellen gesucht, die in der NS-Zeit verfolgt wurden. Wartelsteiner schreibt ein Buch über Schwarze, das seine Homosexualität in den Mittelpunkt rückt. Darüber ärgert er sich immer wieder. Dennoch kann er von dem Buch nicht lassen, ganze Textpassagen kennt er auswendig. Schwarze ist es ungeheuer wichtig, dass der eigentliche Grund seiner Verhaftung ein politischer und eben nicht die Homosexualität gewesen sei. Als der Historiker Joachim Müller im Leipziger Staatsarchiv schließlich ein Dokument findet, auf dem als Haftgrund „politisch“ vermerkt ist, reagiert er überschwänglich: „Ja, aber Herr Müller, da haben wir es doch: Politisch. Darum ging es doch. Warum kann man denn das nicht als Hauptfaktum nehmen und nicht immer den § 175 aufblasen... Für mich ist das das Wichtigste. Damit habe ich eine gute Sterbestunde.“ Schließlich geht auch Schwarzes Herzenswunsch in Erfüllung, Rosa von Praunheim kennenzulernen. Ihn bewundert er sehr, auch wenn er seine Biografie für „schrecklich schweinisch“ hält. Praunheim porträtiert Schwarze später in seinem Film „Tote Schwule, lebende Lesben“. Walter Schwarze
stirbt am 10.5.1998 im Alter von 83 Jahren in Leipzig. Literaturtipps: Maxi Wartelsteiner: Rückkehr unerwünscht. Schwul-Sein und das ewig gesunde Volksempfinden. Schkeuditz 1995: GNN. Joachim Müller: „Narben bleiben immer“. Das Leben des Walter Schwarze. S. 359-372 in: Müller / Sternweiler: Homosexuelle Männer im KZ Sachsenhausen. Berlin 2000: Rosa Winkel. Alexander Zinn:
»Aus dem Volkskörper entfernt«? Homosexuelle
Männer im Nationalsozialismus. |
||
![]()
© Alexander Zinn 2017






